Gibt es einen Gott, der Menschen bestraft?
Nein, sagen viele Christen heute.
Warum glauben manche Menschen an einen strafenden Gott?
Früher haben mächtige Menschen gesagt:
– Gott bestraft die Bösen.
– Gott belohnt die Gehorsamen.
Das war praktisch für Könige und reiche Leute.
Dann hatten arme Menschen Angst.
Und arme Menschen haben gehorcht.
Aber das stimmt nicht mit Jesus überein.
Was hat Jesus über Gott gesagt?
Jesus hat erzählt:
– Gott liebt alle Menschen.
– Gott vergibt.
– Gott will Freiheit für alle.
Jesus war besonders nett zu:
– Armen Menschen
– Kranken Menschen
– Menschen, die andere nicht mochten
Jesus hat nicht gesagt: Gott bestraft euch!
Woher kommt dann das Leid?
Wenn Menschen leiden, liegt das oft an:
– Ungerechten Regeln
– Unfairen Chefs
– Mangel an Geld und Hilfe
Nicht Gott macht das Leid.
Menschen machen das Leid.
Was bedeutet das für uns?
Wir müssen keine Angst vor Gott haben.
Wir sollen für andere Menschen sorgen.
Wir sollen gegen Ungerechtigkeit kämpfen.
Gott will, dass alle Menschen gut leben können.
Kategorie: Allgemein
Kann man Gott beweisen?
Kann man Gott beweisen?
Eine Frage von einem Studenten
Ein Student hat mich gefragt:
„Herr Herzberger, Sie glauben an Gott.
Können Sie beweisen, dass es Gott gibt?“
Ich musste lachen.
Ich kann vieles.
Ich kann Seminare halten.
Ich kann singen.
Aber Gott beweisen?
Das geht nicht.
Was sind Gottesbeweise?
Früher haben kluge Leute versucht, Gott zu beweisen.
Sie haben sich schwierige Gedanken gemacht.
Sie haben Bücher geschrieben.
Aber für mich war das immer zu kompliziert.
Das hatte nichts mit meinem Leben zu tun.
Dietrich Bonhoeffer war ein mutiger Pfarrer.
Er wurde von den Nazis ermordet.
Er hat aus dem Gefängnis geschrieben:
„Einen Gott, den man beweisen kann, brauchen wir nicht.“
Das finde ich richtig.
Eine Geschichte von Michael
Ich erzähle lieber eine Geschichte.
Michael hat eine Behinderung.
Er hat lange in einem Wohnheim gelebt.
Dort hat er alles bekommen:
Essen
Betreuung
Ein Programm für den Tag
Aber Michael war nur jemand, um den man sich kümmert.
Niemand hat ihn gefragt: Was willst du?
Michael beim Netphener Tisch
Dann kam ein neues Projekt.
Der Netphener Tisch.
Das ist eine Lebensmittel-Ausgabe.
Menschen mit wenig Geld bekommen dort Essen.
Michael wollte dort helfen.
Nicht Essen bekommen.
Sondern selbst helfen!
Jetzt arbeitet Michael jeden Mittwoch dort.
Er sortiert Gemüse.
Er packt Tüten.
Er redet mit den Leuten.
Michael ist jetzt nicht mehr nur jemand, der Hilfe bekommt.
Er ist jemand, der anderen hilft.
Wo war Gott?
Kann ich beweisen, dass Gott dabei war?
Nein.
Aber ich habe etwas gespürt.
Als Michael das erste Mal gesagt hat:
„Ich helfe anderen.“
Da war etwas Großes in seinem Gesicht.
Das kann man nicht beweisen.
Das kann man nur erleben.
Gott zeigt sich beim Handeln
Menschen in Südamerika sagen:
„Gott erkennen heißt: Gutes tun.“
Das bedeutet:
Nicht lange über Gott nachdenken.
Sondern etwas Gutes tun.
Wo zeigt sich Gott?
Wenn Menschen nicht mehr klein gehalten werden
Wenn jemand seine Würde zurückbekommt
Wenn aus Ohnmacht Kraft wird
Das ist für mich Gott.
Nicht in klugen Büchern.
Sondern im Leben.
Die schwere Frage
Manchmal fragen mich Leute:
„Wenn es Gott gibt – warum gab es dann Auschwitz?
Warum gab es Hadamar?“
Hadamar ist ein Ort hier in der Nähe.
Dort haben die Nazis Kinder mit Behinderungen ermordet.
Ich habe keine Antwort darauf.
Ich kann das nicht erklären.
Aber ich weiß:
Wir müssen uns an die ermordeten Menschen erinnern.
Und wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.
Auch heute werden manchmal Babys mit Behinderung abgetrieben.
Kurz vor der Geburt.
Das erinnert mich an Hadamar.
Gott zeigt sich dann im Widerstand.
Wenn Menschen sagen: Nein!
Jedes Leben ist wertvoll!
Meine Antwort
Nein, ich kann Gott nicht beweisen.
Aber ich kann erzählen:
Von Michael beim Netphener Tisch
Von vielen anderen Menschen
Von Momenten, wo ich gespürt habe: Da ist mehr
Das ist kein Beweis.
Das ist eine Spur.
Und für mich reicht das.
Wer hat das geschrieben?
Armin Herzberger.
Er hat 35 Jahre mit Menschen mit Behinderung gearbeitet.
Jetzt unterrichtet er an der Universität Siegen.
Gott ist kein Eigentum
Gott ist kein Eigentum
Sie haben ihn in ihre Paläste gesperrt und ihre Dogmen gegossen. Sie haben ihn auf Thronen platziert und in Goldrahmen gehängt. Sie haben seinen Namen benutzt, um Macht zu legitimieren und Ungerechtigkeit zu segnen.
Aber Gott lässt sich nicht besitzen.
Er steht bei den Hungernden, nicht in den Verwaltungsetagen. Er spricht aus dem Mund derer, die man für sprachlos hielt. Er wirkt in den Händen derer, die man für hilfsbedürftig erklärte, wenn sie selbst zu Helfenden werden.
Gott ist kein Eigentum der Frommen. Kein Privileg der Rechtgläubigen. Kein Instrument der Mächtigen.
Wo immer Menschen ihre Faust gegen Unterdrückung erheben, wo immer das Kreuz nicht vergoldet wird, sondern getragen – da ist Gott nicht Besitz, sondern Kraft. Nicht Dogma, sondern Befreiung. Nicht oben, sondern hier.
Die rote Fahne mit dem Kreuz erinnert daran: Der Gott der Bibel war immer schon parteiisch. Für die Geringsten. Gegen die Selbstgerechten.
Niemand kann ihn vereinnahmen. Alle können ihm begegnen.
Weil ich Christ bin
Weil ich Christ bin
27. Januar – Ein Tag, der mich nicht loslässt
Heute vor 80 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Was die Soldaten dort fanden, lässt sich kaum in Worte fassen: ausgemergelte Menschen, Berge von Leichen, Gaskammern, in denen über eine Million Menschen ermordet wurden. Die meisten von ihnen waren Juden. Aber auch Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle, politische Gegner – alle, die nicht ins menschenverachtende Weltbild der Nazis passten.
Als Christ kann ich an diesem Tag nicht schweigen. Ich muss es sogar noch deutlicher sagen: **
Weil ich Christ bin, darf ich nicht schweigen.
Jesus hat uns aufgetragen, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Er hat die Ausgegrenzten in die Mitte geholt, die Kranken geheilt, die Verachteten angenommen. Die Nazis haben genau das Gegenteil getan: Sie haben Menschen nach „wertvoll“ und „lebensunwert“ sortiert. Sie haben aus Nächsten Feinde gemacht. Sie haben die Würde des Menschen mit Füßen getreten.
Und die Kirchen? Viele haben geschwiegen oder sogar mitgemacht. Das ist eine Schuld, die wir nicht vergessen dürfen.
**Deshalb schaue ich heute nicht nur zurück, sondern auch um mich herum.**
Wenn heute wieder Menschen ausgegrenzt werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion oder Herkunft – dann ist das der gleiche Geist, nur in neuem Gewand. Wenn die AfD von „Remigration“ spricht und Menschen ihre Heimat streitig macht, dann höre ich Töne, die ich aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte kenne. Wenn Politiker hetzen statt versöhnen, spalten statt zusammenführen, dann läuten bei mir alle Alarmglocken.
**Weil ich Christ bin, stelle ich mich dagegen.**
Nicht weil ich politisch sein will, sondern weil mein Glaube mich dazu verpflichtet. Die Würde des Menschen ist unantastbar – nicht nur als Grundgesetzartikel, sondern als Kern meines christlichen Glaubens. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Jeder. Ohne Wenn und Aber.
Dietrich Bonhoeffer hat es auf den Punkt gebracht: „Schweigen macht schuldig.“ Er hat für seinen Widerstand gegen Hitler mit dem Leben bezahlt. Ich muss heute Gott sei Dank nicht mein Leben riskieren, wenn ich meinen Mund aufmache. Aber ich muss ihn aufmachen. Gerade jetzt.
**Erinnern heißt handeln.**
Der 27. Januar ist kein Tag für leere Rituale. Er ist ein Tag, der mir zuruft: Schau hin! Misch dich ein! Steh auf, wenn Menschen verächtlich gemacht werden! Das bin ich den Millionen Ermordeten schuldig. Das bin ich meinem Glauben schuldig.
Weil ich Christ bin.
Armin Herzberger, 27. Januar 2025
Der Hauptmann von Kapernaum
Ein Mann arbeitet für die Besatzer.
Er ist Chef von Soldaten.
Die Soldaten unterdrücken das Volk.
Er ist Teil vom System.
Aber dieser Mann ist anders.
Er sieht den kranken Diener.
Nicht: Du musst funktionieren.
Sondern: Du bist mir wichtig.
Er geht zu Jesus.
Er sagt nicht: Ich befehle dir.
Er sagt: Ich bitte dich.
Der Mächtige wird klein.
Jesus sagt: Ich komme mit.
Der Mann sagt: Nein.
Du musst nicht zu mir kommen.
Ich bin Teil der Macht.
Du gehörst zu den Kleinen.
Jesus staunt.
Gerade dieser Mann versteht es:
Gottes Reich dreht alles um.
**Das bedeutet:**
Gott steht auf der Seite der Schwachen.
Auch Mächtige können das verstehen.
Dann müssen sie ihre Macht abgeben.
Glauben heißt: Die Welt umdrehen.
Von unten nach oben denken.
Amen.
Rechts Populismus
Eine Vorlesung in leichter Sprache an der Universität Siegen Studiengang Sozialarbeit Sozialpädagogik BA am 21.01.26
# Behinderten-Hilfe und Rechts-Populismus
##
in Leichter Sprache
Liebe StudentInnen
Es gibt eine wichtige Entwicklung in Europa.
Und auch in Deutschland.
Rechts-populistische Parteien werden stärker.
Das betrifft auch die Behinderten-Hilfe.
Menschen mit Behinderung sind eine schwache Gruppe.
Ihre Rechte sind in Gefahr.
In der Politik hört man oft diese Fragen:
– Was kostet das?
– Ist das nützlich?
– Brauchen wir das wirklich?
Manche sagen:
Inklusion ist nur eine Idee.
Eine schlechte Idee.
Das ist gefährlich.
Wir wissen aus der Geschichte:
So fängt es an.
—
## Gefährliche Argumente
Es gibt 3 Arten von gefährlichen Argumenten.
### 1. Menschen kosten Geld
Manche Leute fragen immer:
Was kostet das?
Sie meinen zum Beispiel:
– Hilfen für Menschen mit Behinderung
– Assistenz
– Barriere-Freiheit
Diese Leute denken:
Ein Mensch ist nur etwas wert,
wenn er Geld verdient.
Aber das stimmt nicht!
Es gibt die UN-Behinderten-Rechts-Konvention.
Deutschland hat sie 2009 unterschrieben.
Dort steht:
Teilhabe ist ein Menschen-Recht.
Kein Geschenk.
Keine Belohnung.
Rechts-Populisten sehen das anders.
Sie ändern langsam,
wie wir darüber reden.
### 2. Starke und schwache Menschen
Rechts-Populisten reden oft von:
– Leistungs-Trägern
– Schmarotzern
Sie meinen:
Manche Menschen arbeiten viel.
Die sind wichtig.
Andere Menschen arbeiten nicht.
Die sind unwichtig.
Menschen mit Behinderung zählen sie zur 2. Gruppe.
Egal, was diese Menschen können.
Egal, was sie tun.
Aber das ist falsch!
Behinderung ist keine Eigenschaft von Menschen.
Behinderung entsteht durch Barrieren.
Barrieren macht die Gesellschaft.
Zum Beispiel:
– Treppen statt Rampen
– Schwere Sprache statt Leichter Sprache
– Keine Hilfen
Rechts-Populisten sagen:
Der Sozial-Staat ist eine Last.
Wir müssen ihn bezahlen.
Für die anderen.
Aber der Sozial-Staat ist wichtig!
Er zeigt:
Wir halten zusammen.
### 3. Wir und die Anderen
Rechts-Populisten sagen oft:
Es gibt ein WIR.
Und es gibt die ANDEREN.
Zum WIR gehören nur manche Menschen.
Zum Beispiel:
– Menschen, die viel arbeiten
– Menschen aus Deutschland
– Menschen ohne Behinderung
Alle anderen gehören nicht dazu.
Rechts-Populisten sagen über Inklusion:
– Das ist Gender-Gaga.
– Das ist Minderheiten-Politik.
– Das schadet der Mehrheit.
Das ist gefährlich.
Denn es zerstört das Mit-Gefühl.
Und es macht Zusammen-Halt kaputt.
—
## Was früher passiert ist
Wir müssen uns erinnern.
An die Nazi-Zeit.
Die Nazis haben über 200.000 Menschen getötet.
Diese Menschen hatten:
– Behinderungen
– Psychische Krankheiten
Die Nazis nannten das: Euthanasie.
Aber es war Mord.
So hat es angefangen:
**Schritt 1:**
Die Nazis haben geredet über:
– Lebens-wertes Leben
– Lebens-unwertes Leben
**Schritt 2:**
Die Nazis haben gerechnet:
Was kostet die Pflege?
Sie haben Filme gemacht.
In den Filmen stand:
Diese Menschen kosten zu viel Geld.
**Schritt 3:**
Die Nazis haben Menschen entmenschlicht.
Sie haben sie genannt:
Ballast-Existenzen.
Minderwertige.
**Schritt 4:**
Die Nazis haben getötet.
### Die Kirchen haben versagt
Die Kirchen haben meistens geschwiegen.
Nur wenige haben widersprochen.
Zum Beispiel:
– Bischof von Galen
– Pfarrer Paul-Gerhard Braune
Aber viele Kirchen haben:
– Geschwiegen
– Mit-gemacht
Das war ein großer Fehler.
### Die Lehre
Diese Geschichte ist nicht lange her.
Sie zeigt uns:
Es kann schnell gehen.
Rechte können verloren gehen.
Wenn wir nicht aufpassen.
Wenn wir zulassen,
dass Menschen nach ihrem Nutzen bewertet werden.
—
## Was heute passiert
Die Gefahr ist real.
Sie ist nicht weit weg.
**In Ungarn:**
Viktor Orbán hat viele Sozial-Leistungen gestrichen.
**In den USA:**
Menschen mit Behinderung haben Angst.
Sie könnten ihre Kranken-Versicherung verlieren.
**In Deutschland:**
Manche Parteien sagen:
Der Sozial-Staat ist eine Hängematte.
Wir erleben auch:
**In Schulen:**
Manche sagen:
Inklusion senkt das Niveau.
Das schadet allen Kindern.
**Bei Assistenz-Leistungen:**
Manche sagen:
Das ist Vollkasko-Mentalität.
Die Leute wollen alles geschenkt bekommen.
**Bei Werkstätten:**
Manche sagen:
Das sind Parallel-Gesellschaften.
**Bei Selbst-Vertretung:**
Manche sagen:
Das sind nur Lobbyisten.
Die wollen nur Geld.
—
## Was wir tun können
### 1. Auf die Sprache achten
Wir müssen aufpassen.
Wie reden Menschen?
Zum Beispiel:
Jemand sagt: Leistungs-Träger.
Dann fragen wir:
Wen meinen Sie damit?
Wer ist kein Leistungs-Träger?
Jemand sagt: Inklusion ist eine Ideologie.
Dann fragen wir:
Was meinen Sie damit?
Warum sagen Sie das?
Jemand fragt: Was kostet das?
Dann fragen wir zurück:
Was ist es uns wert?
Welchen Wert haben Menschen?
Wir müssen widersprechen.
Klar und deutlich.
Nicht nur höflich.
### 2. Menschen mit Behinderung stark machen
Das ist sehr wichtig:
Menschen mit Behinderung sollen nicht nur Hilfe bekommen.
Sie sollen selbst handeln.
Sie sollen mit-gestalten.
Ein Beispiel:
Das Projekt Möglichkeits-Denker.
Es gibt das Projekt seit über 20 Jahren.
Was passiert dort?
Menschen mit Unterstützungs-Bedarf helfen anderen.
Sie arbeiten ehrenamtlich.
Sie sind nicht nur Empfänger.
Sie sind auch Gebende.
Das ist auch politisch wichtig.
Am besten ist:
Menschen mit Behinderung sprechen selbst.
Sie kämpfen selbst für ihre Rechte.
Dafür müssen wir:
– Selbst-Vertretungs-Gruppen unterstützen
– Kurse anbieten zu Politik
– Menschen ermutigen, ihre Meinung zu sagen
### 3. Zusammen arbeiten
Wir können nicht alleine kämpfen.
Wir brauchen Partner.
Zum Beispiel:
– Kirchen
– Gewerkschaften
– Menschen-Rechts-Gruppen
– Alle, die für Solidarität sind
Zusammen sind wir stark.
Wir müssen zusammen-halten.
Für die Menschen-Würde.
### 4. Klar Stellung beziehen
Unsere Verbände müssen klar sein.
Unsere Einrichtungen müssen klar sein.
Wenn Menschen-Rechte angegriffen werden,
dürfen wir nicht neutral sein.
Wir brauchen:
– Klare Aussagen
– Öffentliche Stellungnahmen
– Mut zur Diskussion
Wer für Inklusion arbeitet,
kann nicht unpolitisch sein.
—
## Schluss
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
wir müssen uns entscheiden:
**Ist Behinderten-Hilfe nur ein Job?**
Nur eine Dienst-Leistung?
Nur Verwaltung?
**Oder ist Behinderten-Hilfe ein politischer Auftrag?**
Ein Kampf für eine gerechte Gesellschaft?
Ein Kampf für alle Menschen?
Rechts-Populismus ist eine Gefahr.
Für unsere Arbeit.
Für Menschen mit Behinderung.
Wir müssen antworten.
Unsere Antwort muss sein:
– Wachsamkeit
– Widerspruch
– Solidarität
Jeden Tag.
Überall.
Ohne Ausnahme.
Vielen Dank.
—
*Zeit zum Vorlesen: etwa 11-12 Minuten*
—
## Wichtige Wörter erklärt
**Rechts-Populismus:**
Eine politische Richtung.
Diese Leute sagen:
Manche Menschen sind besser als andere.
Sie sind oft gegen:
– Ausländer
– Schwache Menschen
– Minderheiten
**Vulnerable Gruppen:**
Schwache Gruppen.
Gruppen, die leicht verletzt werden können.
Gruppen, die Schutz brauchen.
**UN-Behinderten-Rechts-Konvention:**
Ein Vertrag.
Viele Länder haben ihn unterschrieben.
Auch Deutschland.
Darin steht:
Menschen mit Behinderung haben besondere Rechte.
Zum Beispiel das Recht auf Teilhabe.
**Inklusion:**
Alle gehören dazu.
Niemand wird ausgeschlossen.
Menschen mit Behinderung leben mitten in der Gesellschaft.
**Sozial-Staat:**
Der Staat hilft Menschen.
Zum Beispiel:
– Bei Krankheit
– Bei Arbeits-Losigkeit
– Bei Behinderung
**Selbst-Vertretung:**
Menschen mit Behinderung sprechen für sich selbst.
Sie kämpfen selbst für ihre Rechte.
Sie brauchen dafür manchmal Unterstützung.
Aber sie entscheiden selbst.
**Empowerment:**
Menschen stark machen.
Menschen befähigen.
Menschen ermutigen,
für sich selbst einzutreten.
21.01.26 Armin Herzberger
Rechtspopulismus
Behindertenhilfe und Rechtspopulismus
„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mir getan.“ Mit diesen Worten aus Matthäus 25 hat Jesus den Maßstab gesetzt, an dem sich Glaube und Kirche messen lassen müssen. Nicht an Bekenntnissen, nicht an Liturgien, nicht an Kirchensteuerzahlen – sondern an der Solidarität mit den Schwächsten.
In Zeiten erstarkenden Rechtspopulismus ist diese Botschaft keine fromme Sonntagsrede, sondern politischer Sprengstoff. Denn wenn Menschen wieder nach ihrem „Nutzen“ bewertet werden, wenn Solidarität als naiv verspottet wird, wenn die „Geringsten“ zu Kostenfaktoren degradiert werden – dann steht das Evangelium selbst zur Disposition.
## Die biblisch-theologische Grundlage
**Die Option für die Schwachen**
Die Bibel ist von Anfang bis Ende parteiisch. Sie ergreift Partei für die Unterdrückten, die Ausgegrenzten, die an den Rand Gedrängten. Die Propheten Israels geißeln die Reichen und Mächtigen: „Weh denen, die Häuser an Häuser reihen und Acker an Acker fügen!“ (Jesaja 5,8). Amos schreit: „Sie verkaufen den Unschuldigen um Geld und den Armen um ein Paar Schuhe“ (Amos 2,6).
Jesus radikalisiert diese prophetische Tradition. Er heilt am Sabbat und sagt: „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat“ (Markus 2,27). Er isst mit Zöllnern und Sündern. Er berührt Aussätzige. Er stellt ein Kind in die Mitte und sagt: „Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen“ (Markus 10,15).
Das Reich Gottes, das Jesus verkündet, ist radikal inklusiv. Es kennt keine „Leistungsträger“ und keine „Empfänger“. Es kennt nur Gottes bedingungslose Liebe zu allen Menschen – gerade zu denen, die von der Gesellschaft als wertlos angesehen werden.
**Die Würde des Menschen als Gottesebenbildlichkeit**
„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“ (Genesis 1,27) – dieser Satz ist revolutionär. Er bedeutet: Jeder Mensch trägt die Würde Gottes in sich. Nicht weil er etwas leistet, nicht weil er produktiv ist, nicht weil er der Gemeinschaft „nützt“ – sondern weil Gott ihn liebt und gewollt hat.
Die reformatorische Rechtfertigungslehre radikalisiert das noch: Der Mensch ist gerecht nicht durch Werke, sondern allein durch Gnade. Wir müssen uns unseren Wert nicht verdienen. Wir haben ihn geschenkt bekommen.
Diese Theologie ist die schärfste Waffe gegen jeden Sozialdarwinismus, gegen jede Leistungsideologie, gegen jeden Versuch, Menschen nach ihrem „Nutzen“ zu sortieren.
## Rechtspopulistische Rhetoriken als Häresie
Lassen Sie mich das beim Namen nennen: Rechtspopulistische Ideologien sind aus christlicher Sicht Häresien – Irrlehren, die dem Evangelium fundamental widersprechen.
**Die Häresie der Ökonomisierung**
„Was kostet uns das?“ – Diese Frage wird gestellt, als gäbe es einen Preis für Menschenwürde. Als könnte man Teilhabe gegen Haushaltszahlen aufrechnen. Als wäre der Wert eines Menschen in Euro messbar.
Jesus sagt: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Matthäus 16,26). Die Logik des Marktes ist nicht die Logik des Reiches Gottes. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Matthäus 20) bekommen alle denselben Lohn – unabhängig von ihrer Leistung. Das ist ökonomisch absurd. Das ist theologisch präzise.
**Die Häresie des Sozialdarwinismus**
„Leistungsträger“ und „Schmarotzer“ – diese Unterscheidung ist zutiefst unchristlich. Paulus schreibt: „Wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft… und die Glieder des Leibes, die uns die schwächsten scheinen, sind die nötigsten“ (1. Korinther 12,22).
Die Kirche ist kein Leistungskollektiv der Starken. Sie ist Gemeinschaft der Erlösten – und gerade die Schwachen sind ihr Herzstück. Wo Rechtspopulisten von „Ballast“ reden, spricht Paulus von „den nötigsten Gliedern“. Das ist kein Zufall. Das ist Theologie.
**Die Häresie der Exklusion**
Rechtspopulismus arbeitet mit einem „Wir gegen die Anderen“. Das Evangelium sagt: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ (Galater 3,28).
Das Reich Gottes ist grenzenlos inklusiv. Das große Abendmahl (Lukas 14) lädt die Armen, Krüppel, Blinden und Lahmen ein – genau die, die in der Gesellschaft nichts zählen. Sie sind nicht geduldet. Sie sind die Ehrengäste.
## Die historische Schuld der Kirche
Wir müssen bekennen: Die Kirchen haben in der NS-Zeit mehrheitlich versagt. Sie haben nicht die prophetische Stimme erhoben, als Menschen mit Behinderungen zu „lebensunwertem Leben“ erklärt wurden. Sie haben – mit rühmlichen Ausnahmen wie Bodelschwingh, von Galen, Braune – geschwiegen oder kollaboriert.
Die Kirche der Angepassten, die Kirche der Hierarchien, die Kirche der Staatsräson – sie hat das Evangelium verraten. Dietrich Bonhoeffer hat es klar formuliert: „Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen.“
Diese Schuld verpflichtet uns heute. Die Kirche muss prophetisch sein – oder sie ist keine Kirche Jesu Christi. Sie muss an der Seite der Schwachen stehen – oder sie verrät ihren Auftrag.
**Die Lehre: Kirche von unten**
Was wir brauchen, ist keine Amtskirche, die von oben herab verkündet. Was wir brauchen, ist „Kirche von unten“ – eine Bewegung von Menschen, die im Geist Jesu solidarisch handeln. Die Basisgemeinden Lateinamerikas haben es vorgemacht. Die Friedensbewegung in der DDR hat es praktiziert. Die Flüchtlingskirche tut es heute.
Kirche von unten bedeutet: Wir fragen nicht zuerst, was die Institution Kirche sagt. Wir fragen: Was würde Jesus tun? Und dann handeln wir – notfalls gegen kirchliche Hierarchien, notfalls in zivilem Ungehorsam, notfalls als „unbequeme Propheten“.
## Aktuelle Bedrohungen – prophetisch benannt
Die Bedrohung ist real. In Polen werden Sozialleistungen gekürzt. In Ungarn wird der Sozialstaat demontiert. In Deutschland wird Inklusion als „Ideologie“ diffamiert. Das sind keine politischen Spielchen. Das sind Angriffe auf die Würde von Gottes Geschöpfen.
Und die Kirche? Redet von „Bewahrung der Schöpfung“ – und meint vor allem Bäume. Redet von „christlichen Werten“ – und meint vor allem bürgerliche Moral. Aber schweigt zu oft, wenn Menschen konkret bedroht sind.
## Was wir tun müssen – ein prophetischer Auftrag
**Erstens: Die prophetische Stimme erheben**
Wir müssen widersprechen. Laut. Klar. Öffentlich. Wenn von „Leistungsträgern“ die Rede ist – widersprechen. Wenn Inklusion als „Ideologie“ diffamiert wird – widersprechen. Wenn Menschen zu Kostenfaktoren gemacht werden – widersprechen.
„Weh den Hirten Israels, die sich selbst weiden!“ ruft Hesekiel (34,2). Heute würde er rufen: „Weh den Politikern, die die Schwachen verraten! Weh den Ökonomen, die Menschenwürde berechnen! Weh den Theologen, die schweigen, wenn Unrecht geschieht!“
**Zweitens: Empowerment als diakonischer Auftrag**
Menschen mit Behinderungen sind nicht Objekte christlicher Barmherzigkeit. Sie sind Subjekte des Reiches Gottes. Mein Projekt „Möglichkeitsdenker“ versucht das praktisch: Menschen mit Unterstützungsbedarf werden zu Gebenden, zu Helfenden, zu Mitgestaltenden.
Das ist nicht sozialarbeiterische Technik. Das ist gelebte Theologie. Denn im Reich Gottes gibt es keine passiven Empfänger. Dort sind alle berufen, alle begabt, alle gesandt.
„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum“ (1. Petrus 2,9) – das gilt für alle. Auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Auch für Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Alle sind berufen. Alle haben Gaben. Alle haben eine Stimme.
**Drittens: Solidarische Bündnisse schmieden**
Die ersten Christen nannten sich „ekklesia“ – Versammlung, Gemeinschaft. Sie teilten ihren Besitz. Sie ließen niemanden im Stich. „Es war aber die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele“ (Apostelgeschichte 4,32).
Das ist unser Modell: Bündnisse der Solidarität. Mit Gewerkschaften, die für gerechte Löhne kämpfen. Mit Friedensbewegungen, die Gewalt widerstehen. Mit Flüchtlingsinitiativen, die Grenzen überwinden. Mit allen, die das Reich Gottes bauen – ob sie es so nennen oder nicht.
Helmut Gollwitzer hat gesagt: „Die Frage ist nicht, ob wir Sozialisten oder Kapitalisten sind. Die Frage ist, ob wir Christen sind.“ Christen sind wir dort, wo wir für die Schwachen eintreten.
**Viertens: Institutionelle Prophetie**
Unsere Einrichtungen, unsere Verbände, unsere Kirchen müssen Position beziehen. Nicht mit diplomatischen Floskeln. Nicht mit „einerseits-andererseits“. Sondern klar.
Die Barmer Theologische Erklärung von 1934 ist unser Vorbild: „Wir verwerfen die falsche Lehre…“ – so muss es klingen. Wir verwerfen die falsche Lehre, dass Menschen nach ihrem Nutzen bewertet werden dürfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, dass Solidarität naiv ist. Wir verwerfen die falsche Lehre, dass es „nützliche“ und „unnütze“ Leben gibt.
Die Hoffnung des Glaubens
wir leben nicht aus Angst, sondern aus Hoffnung. Nicht aus dem Bemühen, das Böse zu verhindern, sondern aus der Verheißung, dass Gottes Reich kommt. „Selig sind die Friedfertigen, selig die Barmherzigen, selig, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit“ (Matthäus 5).
Das Reich Gottes ist schon angebrochen. Nicht als ferner Traum, sondern als gegenwärtige Wirklichkeit – überall dort, wo Menschen solidarisch handeln, wo Schwache gestärkt werden, wo Liebe die Logik der Macht überwindet.
Rechtspopulismus ist mächtig. Aber das Evangelium ist mächtiger. Die Frage ist nur: Glauben wir das? Und wenn ja: Leben wir danach?
Martin Luther King sagte: „Unsere Leben beginnen zu enden an dem Tag, an dem wir über Dinge schweigen, die wichtig sind.“
Lasst uns nicht schweigen. Lasst uns Kirche sein – prophetisch, solidarisch, unbequem. Kirche von unten. Kirche der Geringsten. Kirche Jesu Christi.
„Suchet der Stadt Bestes „
Eine Weggeschichte
„Es ist kein Stuhl mehr für dich da“
Dieser Satz aus meiner Kindheit sitzt noch heute. Ein trüber Novemberabend, zwei Gemeindeälteste an der Haustür. Sie kamen, um die Gesangbücher abzuholen.
„Du warst seit über einem halben Jahr nicht mehr im Gottesdienst. In der Bibelstunde fast ein ganzes Jahr nicht. Andere Leute haben auch viel zu tun. Es ist sowieso kein Stuhl für dich da.“
Schweigend nahmen sie die Bücher mit. Fertig.
Die Botschaft kam an: Wer nicht mitmacht, fliegt raus. Dein Platz ist weg.
So wurde Glaube für mich etwas Bedrohliches. Die Bibel als Druckmittel. Gemeinde als Kontrollsystem. Angst statt Hoffnung.
Dann hab ich angefangen nachzudenken
Das war vor einiger Zeit. Durch meine Arbeit im Kirchenvorstand. Durch die lebensbedrohliche Erkrankung meiner Frau.
Ich hatte Gespräche mit einer Pfarrerin. Sie las die Bibel anders. Sie stellte andere Fragen.
Sie erzählte Geschichten. Sinnstiftende Geschichten.
Nicht als Drohung. Nicht als Kontrolle. Sondern als Geschichten, die Leben deuten. Die Hoffnung machen. Die zeigen: Du bist nicht allein.
Das hat mich tief berührt.
Sie fragte zum Beispiel beim barmherzigen Samariter: „Warum liegt der Mann überhaupt halb tot am Straßenrand? Wer profitiert davon?“ Plötzlich ging’s nicht mehr nur um individuelle Hilfe, sondern um Strukturen, die Menschen zu Opfern machen.
Sie ist jetzt nicht mehr da. Vergessen werd ich sie nicht.
Am Anfang dachte ich: Das kann nicht stimmen. Gott ist doch neutral.
Aber dann hab ich die Geschichten nochmal gelesen – und erkannt:
Gott ist nicht neutral. Im Gegenteil.
Der Exodus: Gott befreit Sklaven. Nicht weil sie fromm waren. Sondern weil Sklaverei falsch ist.
Jesus war Jude. Er war nicht nur bei den Ältesten, sondern vor allem bei den Ausgestoßenen. Bei denen, für die „kein Stuhl da war“. Beides gehört zusammen. Davon lernen wir untereinander.
Die Bergpredigt: „Selig sind die Armen“ – keine Vertröstung. Sondern eine Kampfansage: Die jetzige Ordnung ist falsch.
Nach und nach hab ich verstanden: Die Bibel erzählt keine Geschichten über brave Kirchgänger. Sie erzählt von Leuten, die sich gegen Unterdrückung wehren.
Das hat was mit mir gemacht?
Ich hab angefangen, anders zu denken. Über die Jahre damals. Über die Angst. Über das, was man mir beigebracht hatte.
Manchmal kam Wut hoch. Auf die Gemeindeältesten von damals. Auf ein System, das aus Gott einen Kontrolleur macht.
Aber auch: Erleichterung. Eine Last fiel ab. Ich musste nicht mehr gut genug sein. Musste mich nicht mehr rechtfertigen.
Und dann: Hoffnung. Wenn die Bibel wirklich von Befreiung erzählt, dann ist Veränderung möglich. Dann muss es nicht so bleiben, wie es ist.
Was ich verstanden habe:
Gott steht nicht über allem – er hat sich für eine Seite entschieden. Auf der Seite derer, die unten sind. Das ist Politik. Und Frömmigkeit. Beides gehört zusammen.
Jesus war beides: Seelsorger und Störenfried. Er hat sich um Menschen gekümmert UND die Mächtigen konfrontiert. Er hat geheilt UND die religiöse Elite herausgefordert. „Selig sind die Armen“ ist Tröstung UND Kampfansage zugleich.
Gemeinde kann anders sein. Nicht: Wer hat die Macht? Sondern: Wie stärken wir uns gegenseitig? Nicht Leistung als Maßstab, sondern Gerechtigkeit.
Der Weg zählt, nicht das Ankommen. Die Bibel ist voll von Weggeschichten. Es geht ums Unterwegssein. Wie wir miteinander umgehen. Ob wir niemanden zurücklassen.
Was das praktisch bedeutet:
Bei den „Möglichkeitsdenkern“ der Lebenshilfe.
Ich arbeite mit Menschen, die Unterstützung brauchen. Wir fragen nicht: „Was können die nicht?“ Sondern: „Was können die?“
Menschen, die jahrelang nur „betreut“ wurden, organisieren jetzt selbst Veranstaltungen. Engagieren sich. Haben eine Stimme.
Das ist konkret, was die Bibel meint: Menschen werden befreit. Nicht durch fromme Worte. Durch echte Teilhabe.
Als Kirchenvorstand:
Oft erlebe ich den Widerspruch: Kirche redet von Nächstenliebe – und nimmt Ehrenamtliche oft als selbstverständlich hin.
Ich versuche gegenzusteuern. Entscheidungen transparent machen. Ehrenamtliche stärken und wertschätzen. Kirche öffnen für alle.
Ziemlich schwer. Die Strukturen sind zäh. Aber manchmal geht was.
An der Uni:
Ich unterricht Soziale Arbeit. Und ich sag den Studierenden: „Gute Soziale Arbeit fragt nicht nur: Wie helfen wir? Sondern auch: Warum brauchen Menschen überhaupt Hilfe?“
Warum gibt es Armut in einem reichen Land? Warum werden Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt? Das sind politische Fragen.
Was ich gewonnen habe.
Diese andere Art, die Bibel zu lesen, hat mir Freiheit gegeben:
Frei von der Angst, nicht gut genug zu sein. Vom Druck, ständig was leisten zu müssen. Von religiöser Kontrolle.
Frei für Solidarität mit denen, die unten sind. Für politisches Engagement. Für die Hoffnung, dass sich was ändern kann.
Frei mit allen, die ebenfalls auf der Suche sind. Mit denen am Rand. Mit allen, für die „kein Stuhl da ist“.
Die Suche geht weiter
Ich hab keine fertigen Antworten. Hab ich auch nie gehabt. Die Suche nach Gott hört nie auf.
Aber ich hab verstanden, wo ich suchen muss:
Nicht in perfekten Gottesdiensten. Sondern dort, wo Menschen befreit werden.
Nicht nur in frommen Bibelstunden. Sondern dort, wo Gerechtigkeit geschieht.
Nicht dort, wo Stühle weggenommen werden. Sondern dort, wo Tische gedeckt werden für alle.
Genau so was haben wir jetzt gerade. Der Nachbarschaftsraum in Breidenbach.
Das ist keine fromme Idee. Das ist eine notwendige Maßnahme. Weil Kirche in Zukunft nicht anders überleben kann. Nicht als Institution, die sich selbst erhält. Sondern als Kirche, die nah bei den Menschen ist.
Die Ängste sind da. Wird das funktionieren? Wie finanzieren wir das? Was, wenn’s schief geht?
Aber auch die Hoffnung. Die Chance, was Neues entstehen zu lassen. Einen Ort, wo Gemeinde wirklich Gemeinde ist. Nicht nur in Sonntagsgottesdiensten, sondern im Alltag.
Dabei wollen wir die alten Menschen mitnehmen. Beide Gruppen sind wichtig – die, die was Neues wagen, und die, die die Tradition kennen. Die Tradition ist auch wichtig. Aber sie ist nicht in Stein gemeißelt. Sie muss sich wandeln, wenn sie leben soll.
Alfred Delp, der Jesuitenpater, der im Widerstand gegen die Nazis war und dafür hingerichtet wurde, hat aus dem Gefängnis geschrieben:
„Man muss die Segel in den unendlichen Wind stellen, dann erst werden wir spüren, welcher Fahrt wir fähig sind.“
Wir setzen die Segel. Nicht weil wir so mutig sind. Sondern weil wir keine andere Wahl haben, wenn wir ehrlich sein wollen.
Gott baut sein Reich nicht mit Steinen, sondern mit Menschen.
Und Karl Barth hat es gesagt: „Seid ohne Angst – es wird regiert.“
Nicht von uns. Nicht von Kirchenvorständen. Nicht von perfekten Konzepten.
Sondern von dem Gott, der schon immer auf der Seite derer war, die was Neues wagen mussten.
Dieser Weg ist nicht einfach. Nicht bequem. Er macht einen manchmal unbequem für andere.
Aber er ist frei.
Der gemeinsame Weg ist gemeinschaftlich oder er ist gar nicht.
Niemand kann allein befreit werden.
„Suchet der Stadt Bestes“
Ich bin Autodidakt
Eine Satire
Samstag, Baumarkt. Kellerausbau mit Sauna. YouTube sagt „kinderleicht“.
Vier Stunden später: Dampfsperre an mir, nicht an der Wand. Rigips kaputt. Finger blutig. Aber weiter geht’s! Irgendwann wird das die geilste Sauna ever.
Ich bin nicht nur im Keller Heimwerker.
**Heimwerken an der Inklusion**
Berlin bastelt Bundesteilhabegesetz. Ohne Anleitung. Ohne die Betroffenen zu fragen.
Drei Anträge, um aufzustehen. Fünf Gutachten, um zur Arbeit zu fahren. Wer nicht bürokratiefest ist, bleibt liegen.
Deutsche Gründlichkeit nennen wir das.
Bei meiner Sauna frag ich den Fachmann. Bei Menschen mit Behinderung? „Ach, das krieg ich auch so hin!“
**Heimwerken an der Kirche**
Strukturreform mit Beraterhonoraren. „Kirche von unten“ – von oben gemacht.
Ehrenamtliche brennen aus? Nicht so zimperlich! Früher ging’s auch.
Gottesdienste leer? Fusionieren! Drei Tote sind ein Lebendiger.
Bei 400 Volt hol ich den Elektriker. Bei der Gemeinde? „Haben wir schon immer so gemacht!“
**Heimwerken in der Verwaltung**
Formular. Kästchen. Unterschrift nur persönlich. Dienstags 9-11:30 Uhr.
„Geht das einfacher?“ – Wo kämen wir da hin! Dann könnte ja jeder!
**Das Prinzip**
Im Keller: Sofort Schimmel. Mein Problem.
In der Gesellschaft: Kollaps nach Jahren. Bin dann befördert.
Inklusion gescheitert? „War schon immer schwierig.“
Gemeinden tot? „Strukturwandel.“
Demokratie müde? „Wollen halt nicht.“
Die Betroffenen hätten halt bei der Umfrage mitmachen sollen. Von 2019.
Von vorne sieht man’s kaum.
Meine Sauna wird super. Irgendwann.
Wie die Inklusion.
Wie die Kirche.
Wie die Bürgernähe.
Kinderleicht.
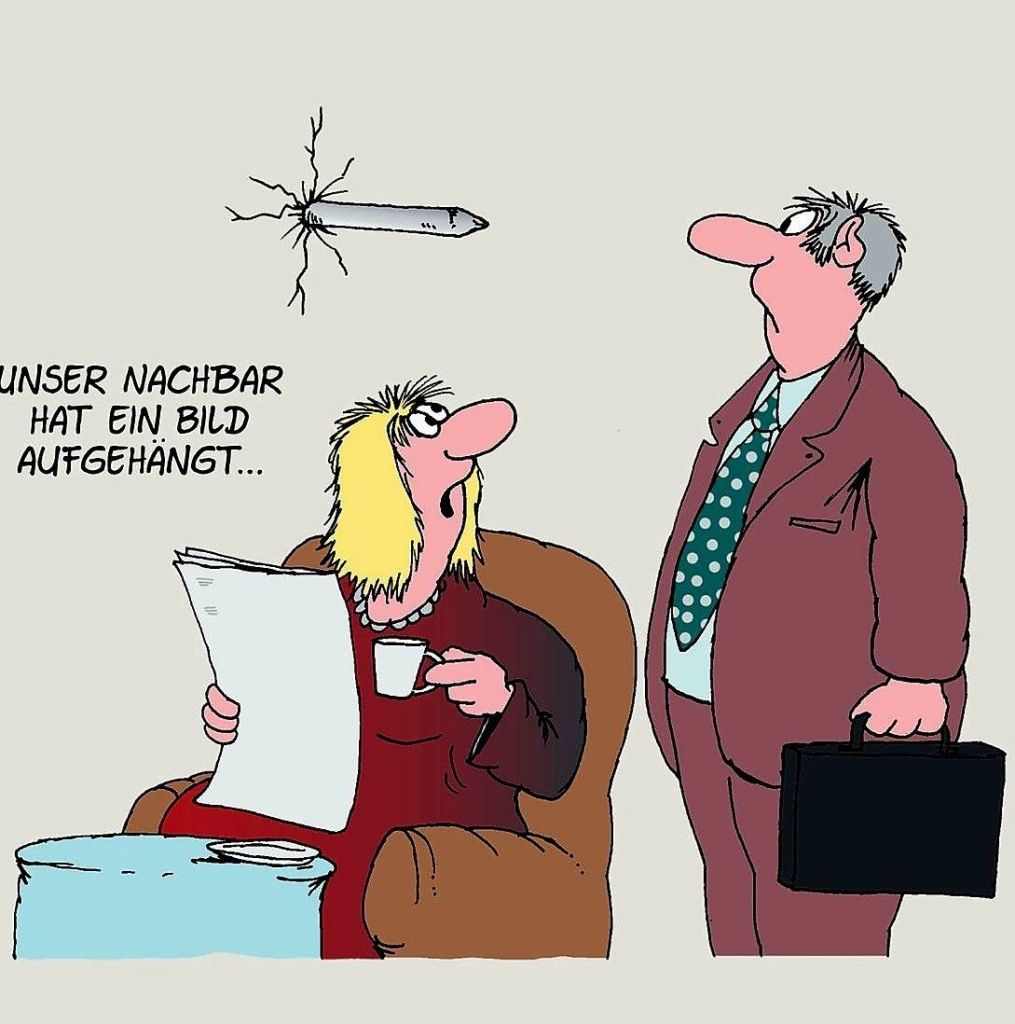


Besuch der Möglichkeitsdenker – Lebenshilfe Lüdenscheid
Vanessa und Wolfgang Nollmann berichten über EUTB
Vanessa und Wolfgang Nollmann waren zu Gast an der Universität Siegen.
Sie haben den Studierenden von ihrer Arbeit erzählt.
Auch andere Fachleute waren dabei:
- Vertreter von der Lebenshilfe Lüdenscheid
- Vertreter von der Lebenshilfe Marburg
- Mitarbeiter von der EUTB Lüdenscheid
Was ist EUTB?
EUTB bedeutet: Ergänzende unabhängige Teilhabe-Beratung.
Das ist eine Beratungs-Stelle für Menschen mit Behinderung.
Die Berater helfen bei vielen Fragen:
- Welche Rechte habe ich?
- Wo bekomme ich Unterstützung?
- Wie kann ich selbstbestimmt leben?
Was war besonders?
Vanessa und Wolfgang Nollmann arbeiten bei der Lebenshilfe.
Sie kennen die Praxis sehr gut.
Zusammen mit den anderen Experten haben sie den Studierenden gezeigt:
- Wie Beratung wirklich funktioniert
- Was Menschen mit Behinderung brauchen
- Welche Probleme es im Alltag gibt
- Wie verschiedene Organisationen zusammen-arbeiten
Wie kam es zu diesem Besuch?
Die Idee kam von Armin Herzberger.
Er ist Lehrbeauftragter an der Universität Siegen.
Er hat die Verbindung zwischen Universität und Praxis hergestellt.
Ihm ist wichtig: Studenten sollen echte Experten kennen-lernen.
Warum ist das wichtig?
Die Studierenden lernen viel aus Büchern.
Aber echte Experten aus der Praxis sind noch wichtiger.
Sie zeigen: So sieht die Arbeit wirklich aus.
Sie erzählen von echten Situationen.
Die Bilder zeigen die Experten bei ihrer Arbeit im Seminar.
Man sieht: Sie arbeiten konzentriert.
Und sie erklären den Studierenden viel.



